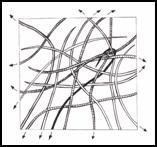3.5 Verarbeitungstechnik FilzenGerade heute bietet das Filzen für die Bewohnerin einer Industrienation einen Zugang zum Archaischen. Filzen setzt den käuflichen Fertigprodukten etwas Eigenständiges, Natürliches entgegen. Etwas, was an die Wurzeln der menschlichen Existenz erinnert. Es befriedigt die Sehnsucht nach natürlich gewachsenen, reinem Material und der Ausübung eines Handwerkes im ursprünglichen Sinne. Wie ursprünglich die Technik des Filzens ist, zeigt sich schon in der Ethymologie des Begriffs. „Das Wort Filz, mittelhochdeutsch „ vilz“, englisch „felt“, ist westgermanischen Ursprungs und bedeutet „gestampfte Masse“.“ 45 Das Filzen hat eine Jahrhunderte alte Tradition. „Viele Geschichten erzählen, wie entdeckt wurde, dass sich Wolle verfilzt. Eine davon geht auf die Arche Noah zurück. Sie berichtet, dass die armen Schafe in der Arche nicht so viel zu Fressen bekamen. Da sie außerdem auf engem Raum standen und sich wärmten, begannen sie, ihre Wolle zu verlieren, die schliesslich unter ihnen auf dem Boden lag. Sie urinierten auf diese Wolle, tampelten darauf herum und was geschah? Als die Schafe die Arche verlassen hatten, hinterliessen sie einen gefilzten Teppich! . . . In dieser Geschichte kommen alle wichtigen Elemente der Filzherstellung vor: Wolle, die alkalische Walkflüssigkeit (hier der Urin) und die mechanische Bearbeitung (das Trampeln), die bewirkt, dass sich die Wolle verfilzt.“ 46
Die Schuppen der Wollfasern können sich durch den Einfluß von Wärme, Feuchtigkeit und Mechanik dauerhaft ineinander verhaken. Die nativen Eiweißfasern sind die einzigen textilen Fasern, die filzen. Diese Eigenschaft wird beim Filzen genutzt. Es beginnt mit dem Auseinanderzupfen des Wollvlieses und dem behutsamen Auslegen der Wolle im trockenem Zustand. Nach einer ersten Zugabe von heißem Seifenwasser beginnt man zunächst ganz leicht über die Wolle zu reiben, um die ersten Verbindungen der Fasern zu schaffen. Dafür ist leichtes Reiben und Kreisen der Hände auf der Wolle empfohlen, erst später folgt ein kräftiges Walken. „Und die Hände müssen spüren, wann die Wolle soweit ist, kräftiger bearbeitet zu werden.“ 47 Es ist die Wolle selbst, die die Geschwindigkeit der Verarbeitung angibt. Guter Filz braucht Zeit. Wolle stößt naturgemäß Wasser ab. Aber Wasserdampf dringt in die Fasern ein. Es muß also beim filzen mit heißem Wasser gearbeitet werden. Durch die Bewegungen reiben die Wollfasern aneinander, es entsteht Wärme und dadurch gelangt Wasserdampf in die Fasern. In der Mongolei ist es noch heute Brauch, daß nasse Vlies in einen Mutterfilz zu einer Rolle einzurollen. Anschließend wird er mittels Pferden über den Boden der Steppe gezogen. Durch die so erzeugte Hitze spart man kostbares Brennmaterial.
Der Ausführung des Filzens sind keine Grenzen gesetzt. Der Filz kann entweder in Reibetechnik auf einer Unterlage entstehen, oder er wird, in Stoffbahnen und Bambusmatten gewickelt, gerollt. Auch ist es möglich Filz mittels der Waschmaschine oder des Dampfkochtopfes herzustellen. In der vorliegenden Kollektion wird experimentell mit diesen Grundtechniken umgegangen. Bei allen Filztechniken wird der Filz anfangs öfters kontrolliert, damit keine unerwünschten Erscheinungen auftreten. Wenn sich die Wollfasern kräftig verhakt haben, wird der Filz gewalkt, daß heißt, er wird kräftig bearbeitet. Größere Flächen werden mitunter auf den Boden geworfen. Wenn der Prozeß des Walkens richtig ausgenutzt wird, können sich die Wollfasern nicht mehr verschieben. Ein Pillingeffekt, wie er bei nicht bis zum Schluß ausgewalkten Filzen auftritt, entfällt dann. Pilling bedeutet unerwünschte Knötchenbildung an Textiloberflächen. |