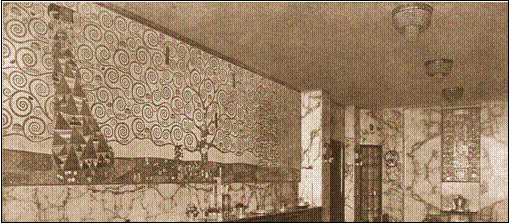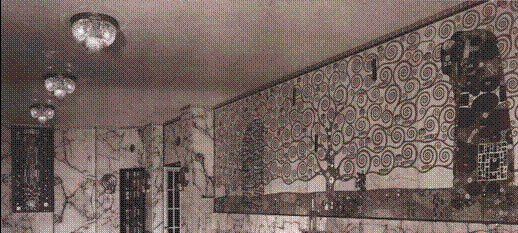2.3 Der Mosaik - FriesEntstehung und Material
Da sich das Palais bis heute im Besitz der Familie Stoclet befindet, ist die Quellenlage, den Fries und die Baumaßnahmen betreffend, bis heute unerforscht. Die Unterlagen befinden sich – so sie noch existieren – bei den Besitzern. Über die Anfänge des Werkes, bzw. über einem Kompositionsentwurf als Vertragsgrundlage mit erfolgten Änderungen ist deshalb kaum etwas bekannt. Sicher gab es einen Austausch der Vertragspartner über den Fries, und Klimt lernte die Kunstsammlung des Ehepaares kennen. 11 „Die wunderbaren Farben, Formen und edlen Materialien dieser Sammlung trugen sicher sehr wesentlich dazu bei, den Fries weder al fresco - noch als Relief, sondern in einer kombinierten Technik auszuführen. Hinzu kam, daß diese außerordentliche Sammlung in unmittelbarer Nähe des Speisesaales, in der großen, zweigeschossigen Halle... untergebracht wurde.“ 12 Fest steht, daß der Fries in Einzelteilen in Wien gefertigt, in einzelnen Platten nach Brüssel transportiert und dort montiert wurde. Insgesamt mißt er 15 x 2 Meter und entstand in der Zeit von 1905 bis 1911. Erst 1910 entstanden die Originale. Die ersten kleinen Entwürfe entstanden auf Pergament: Bleistift, Deckweiß, Kreide Aquarell- und Deckfarben, Gold- und Silberbronze. Klimt fertigte diese wohl 1908 am Attersee an. 13 Klimt war sehr genau in der Umsetzung seiner Entwürfe. Nachdem die Vorzeichnung auf die Marmorplatte übertragen war und diese mit dem Bohrer herausgeholt wurde, hatte er die Konturen noch einmal überprüft. 14 Der Fries entstand in Leopold Forstners Mosaikwerkstätte. Trotz der Vorbereitungen Klimts bedurfte es großer Kenntnisse und Erfahrungen der Werkkünstler. „Mit elf Goldproben... stellte F o r s t n e r die mühsamsten Versuche an, bis die Absicht des Originals >>Klimtisch<< erreicht wurde. So hat auch Fräulein v. S t a r c k ein Virtuosenstück zuwege gebracht. An die zweihundert Blätter trägt der Rosenbusch, und die Palette des Meisters wußte für jedes einzelne Blatt eine andere Schattierung von grün zu finden. Dies in Email aber herauszubringen, grenzt an das Gebiet des Unmöglichscheinenden. Besonders wenn man bedenkt, daß die einzelnen Blättchen weiß emailliert in den Schmelzofen geschoben werden und der chemische Umwandlungsprozeß zur Färbigkeit von dem Künstler v o r h e r dosiert, erraten, erfühlt werden muß. All diese Forderungen aber sind restlos erfüllt, ebenso wie den Metallarbeitern und dem Goldschmiedekünstler der Wiener Werkstätte<< als Meister des Faches eine Kontur von Klimt genügte, um in freier Nachfühlung nach dem zeichnerischen Willen der Linie ihr Material vibrieren zu lassen. Die keramischen Details von L ö f f l e r und P o w o l n y aber, so der Schwarm, schillernder Schmetterlinge und die scharf konturierten Silhouetten der Raubvögel erinnern in der strengen Stileinhaltung des Materialgesetzes, die trotzdem die „Haut der Dinge“ zu lebenserfüllten Oberflächen wirkend macht, an Vorbilder altjapanischer Kunst.“ 15 In Marmorplatten sind Kupfer- und Silberblech, Korallen, Halbedelsteine, Goldmosaik, Email und farbige Fayencen eingelegt. Aufgrund der damaligen künstlerischen Situation in Wien, vor allem nach den Skandalen um Klimt, ist dieser nicht bereit, den Fries vor dem Abtransport nach Brüssel öffentlich auszustellen. „Als nun der Augenblick kam, da vor dem Transport nach Brüssel die Mosaikfresken öffentlich ausgestellt werden sollten, überraschte Klimt seine Freunde durch das von ihm ausgesprochene Verbot dieser Schaustellung. ,Nein! Ich verzichte darauf, mein Werk, das wohl die letzte Konsequenz meiner ornamentalen Entwicklung sein dürfte und an dem so viele Jahre tastender ringender Arbeit haften, ein Werk, an dem mit so viel stillem, aufopferndem Beharren Handwerkskünstler ihr Bestes gesetzt haben, von Beckmesser und Kompagnie verhöhnt und heruntergesetzt zu sehen. Meine Freunde werden den Fries in meinem Atelier besichtigen können. Im übrigen sage ich diesmal: Weg von Wien!...´.“ 16 Aufbau des Fries
Da das Palais nur dem privaten Kreis um die Besitzer des Hauses offensteht, können nur Beschreibungen einen Eindruck von der Wirkung des Werkes vermitteln. Etwa der Text der Journalistin Berta Zuckerkandl. Diese schrieb in der „Wiener Allgemeinen Zeitung“ vom 23. Oktober 1911: „Ein in goldenem Steinchenmosaik ausgeführter, mächtig verzweigter Baum breitet über den marmornen Hintergrund seine Äste. Zu zahllosen Spiralen stilisiert, überschimmern die kraus gewundenen Zweige die Marmorwände in ihrer vollen Ausdehnung. Augartig geformte Früchte, aus getriebenem Metall und Perlmutterstücken gebildet, unterbrechen diese Spirallinien. In den Ästen eingekrallt mit fest angeschlossenen Flügeln und tiefgesenktem Kopf nisten drei Raubvögel, bilden drei tiefschwarze Flecke in dem leuchtendem Gold. Man kennt K l i m t s dichterische Art, Leben darzustellen: Hoffnung, Erfüllung, immer von Drohendem überschattet. Gewöhnlich läßt er neben blühenden Körpern den Tod auftauchen. Diesmal hätte in die Feststimmung eines Prunksaales ein solches Symbol nicht gepaßt. Aber ganz auf den ihm immer lockenden Kontrast von Freude und Unheil..., auf den Gegensatz zwischen drohenden, düsteren, kalten und sinnlich warmen Farbtönen hat der Meister nicht verzichten wollen. So sind die schwarzen, starren Raubvögel im goldenen Lebensbaum wie ein Erinnern, wie eine Mahnung eingesetzt. Links, rechts vom Beschauer blüht ein Rosenbusch, von Schmetterlingen umflattert, ganz flächig komponiert, so daß er ohne jede dazwischen liegende Perspektive die Baumspiralen schneidet. Seitlich rechts, vom goldigen Laub umflossen, steht die Tänzerin. Ein echter Klimt-Typus. Das sehnsüchtig zarte, leise geneigte Antlitz ist auf eine Emailplatte gemalt. Aus Email auch sind die eckig und schmal nach aufwärts sich biegenden Arme. Ein reicher, goldgetriebener, pastisch aufgesetzter Schmuck fällt über die dunklen Haare, umschließt als Spangen und Armbänder die Gelenke. Dann wallt das Kleid herab, oben die Körperlinie umschließend und nach unten glockenförmig sich weitend. Es soll die Phantasie all dieses phantastischen Glanzes noch übertönen. Noch goldener leuchten als der goldene Baum, noch heißer Farbe sprühen als der Rosenbusch. Dreiecke in getriebenem Metall, deren Arabesken blitzende Lichter werfen, wechseln mit Dreiecken aus Emailplatten ab. Diese Platten tragen streifige Muster in allen Farben des Rosarot, des dunkeln und hellenden Blau, des reinen Weiß und des rötlich schimmernden Violett. Man könnte meinen, daß dieser Effekt eine weitere Steigerung polychromer Wirkung und ein Crescendo in Gold nicht mehr zuläßt. Und doch ist der blumige Wiesenrain, der als breites Band den Fries nach unten abschließt, ist diese Wiese, aus welcher der Baumstamm sich reckt, der Rosenbusch sprießt, und auf der die Tänzerin schwebend sich wiegen wird, noch farbentoller, noch glühender, von einem übermütigen Jauchzen der tausend Blumen, Blüten und Blümchen erfüllt, die K l i m t in echter Schöpfungslaune aufsprießen ließ. Es dürften wirklich an tausend Emailblumen sein, die in dem goldig-grünen Mosaikgrund des Rasens eingebettet sind. In ihrer scheinbar ausgestreuten Regellosigkeit liegt die meisterlichste Sicherheit der Fleckwirkung verborgen. Wie nun die Achse des Raumes zu Kampanillen und Kapuzinerln verstärktes Relief durch getriebene Metallstengel und Blätter erhalten; wie diese Akzente zum Baumstamm hinüberleiten, dessen Fuß von schummerig grünem Mosaik des Moosgeflechtes bedeckt ist: wie aus diesem Grün Astlöcher sich ausschneiden, aus Keramik geformte Ovale; und Rindenknorpel, die durch große Kropfperlen und Perlenschalen gebildet sind, diese Kontrastwirkungen durch die Eigenheiten der differenziertesten Materiale ausgedrückt, zeigt ein unerreichtes Können. Der zweite, die Gegenwand bildende Fries,...,wiederholt die Motive, nur daß an Stelle der Tänzerin, die wohl die frühe Jugend versinnbildlichen soll, ein Liebespaar in inniger Umarmung tritt“. 17 |